Die Sieben Thesen: Deutsch als Wissenschaftssprache
Das Erlernen und Weitergeben von Wissen hat sehr viel mit Sprache zu tun. Denn Informationen können nur ausgetauscht werden, wenn es eine gemeinsame Verständigung gibt. Schon früh gab es daher immer eine Art Wissenschafts- bzw. Gelehrtensprache. In der Antike war es das Griechische, selbst als das Römische Reich schon große Ausdehnungen erreicht hat. Später wurde es von Latein abgelöst, was bis ins 18. Jahrhundert die wichtigste Gelehrtensprache war. Abgelöst wurde es dann vom Französischen und Englischen.
Vor allem Englisch wird heute als Sprache der Wissenschaft genutzt, doch ist das nicht nur von Vorteil. Daher haben Wissenschaftler sieben Thesen formuliert, die sich mit Deutsch als Wissenschaftssprache beschäftigen. Die Grundthese lautet: Eine Abkehr des Deutschen in der Wissenschaft sorgt für eine Schwächung der Gesellschaft und des Gedankenaustauschs. Alles weitere zu den Thesen gibt es in diesem Artikel nachzulesen.
Deutsche Sprache der Wissenschaft: 7 Thesen
In den sieben Thesen wird dargelegt, warum eine vollkommene Abkehr der deutschen Sprache im Wissensaustausch ein großer Nachteil wäre. Daraus werden auch Forderungen und Lösungsansätze abgeleitet.
These 1
Bei der ersten These geht es darum, dass Englisch als Lingua Franca – also als allgemeine länderübergreifende Sprache – eine wichtige Rolle spielt und alle Wissenschaftler, die international tätig sind, ihre Arbeiten auch in englischer Sprache veröffentlichen müssen.
Nur so kann Wissen global geteilt werden, was letztendlich ein wichtiger Aspekt von Wissenschaft ist. Diese Vormachtstellung des Englischen wird nicht angezweifelt. Die meisten Publikationen und Konferenzen werden daher auch in Englisch veröffentlicht bzw. geführt.
These 2
Auch wenn das Englische als wichtigste Sprache akzeptiert wird, ist es wichtig, dass im deutschen Wissenschaftsbetrieb Deutsch eine große Rolle spielt. Wenn auch intern nur Englisch genutzt wird, erschwert sich dadurch der Austausch von Gedanken. Auch wenn Wissenschaftler in der Regel Englisch beherrschen, ist der Austausch über komplexe Zusammenhänge und Nuancen sehr schwierig in einer Fremdsprache, die man vielleicht nicht von Kindesbeinen an gelernt hat.
These 3
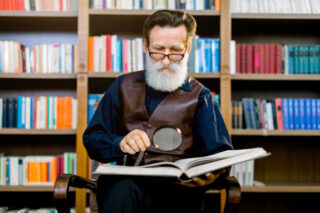
These 4
Englisch hat enorme Vorteile, um als Universalsprache der Wissenschaft zu dienen. Viele Wissenschaftler nutzen daher auch gerne das Englische, das sich in vielerlei Hinsicht etabliert hat. Doch genau das verhindert auch eine Weiterentwicklung der deutschen Wissenschaftssprache und ihrer fächerspezifischen Terminologien. Je mehr Deutsch genutzt wird, desto eher kann die Sprache für die Wissenschaft, die sich stetig weiterentwickelt, genutzt werden.
These 5
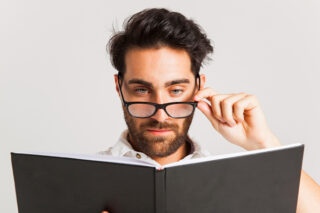
These 6
Für Wissenschaftler und Studenten, die in ein anderes Land gehen, spielt die Sprache oft eine große Rolle. Zwar stellt sie einerseits eine Hürde dar, andererseits aber auch eine Herausforderung und ein spezifisches Herausstellungsmerkmal. Wenn überall Englisch gesprochen wird, könnten viele lieber direkt in ein englischsprachiges Land ziehen, um sozusagen direkt beim Original zu sein. Grundsätzlich sorgt eine eigene gepflegte Sprache dafür, dass der Standort Deutschland attraktiver wird.
These 7

Die Lösungsansätze und Forderungen
Die Wissenschaftler, die die Thesen formuliert haben, haben darüber hinaus auch Forderungen aufgestellt bzw. Lösungsansätze vorgeschlagen. Unter anderem wird gefordert, dass auf nationalen Tagungen deutsch gesprochen wird und es bei internationalen Kongressen Zweisprachigkeit gibt, was durch Simultanübersetzungen ermöglicht werden kann. Oftmals werden Konferenzen in Deutschland nur noch auf Englisch geführt, wenn viele Gäste aus dem Ausland mit dabei sind. Darüber hinaus wurde gefordert, dass in Fachzeitschriften in Deutschland mehr deutschsprachige Artikel erscheinen sollen – mit englischen Zusammenfassungen.

An Universitäten muss Deutsch eine wichtige Rolle spielen. Das bedeutet, dass Lehrveranstaltungen in Deutsch angeboten werden und von ausländischen Studenten entsprechend ausreichende Kenntnisse der Sprache gefordert werden. Sicherlich ist das kurzzeitig eine große Hürde, langfristig können die positiven Effekte aber überwiegen. Anreize können zudem geschaffen werden, wenn Veröffentlichungen in englischen Journals nicht nur nach ihrem hohen Impaktfaktor bewertet werden, sondern auch Publikationen in deutschsprachigen Medien. Zwar ist klar, dass diese Forderungen nicht alle auf einmal umgesetzt werden können, doch auch in Teilen wäre es wichtig, diese zu berücksichtigen.
Wie wirkt sich KI auf wissenschaftliche Sprache aus?
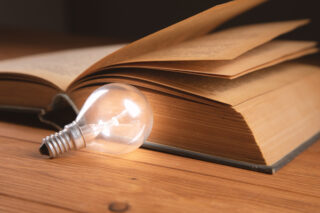
Je mehr Inhalte einer KI überlassen werden, desto weniger Kontrolle haben die Wissenschaftler über diese Inhalte. Das gilt vor allem auch bei Übersetzungen, die sie bei fehlender Sprachkenntnis nur schwer selbst überprüfen können. Zudem scheint es so, als wenn viele KI-Systeme Englisch als Leitsprache haben, was sich entsprechend auch auf die Erstellung der Texte auswirkt. So könnten Stilprinzipien des Englischen auf andere Sprachen wie das Deutsche übertragen werden, sodass letztendlich doch die Hegemonie des Englischen bleibt. Die aktuellen Schwächen gilt es entsprechend für die Zukunft auszumerzen.
Fazit zu den 7 Thesen der Wissenschaftssprache





