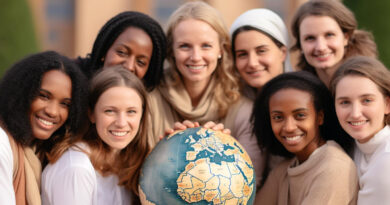E-Learning Tagung GML² 2015 in Berlin
Durch den Ende der neunziger Jahre durchgeführten Bologna-Prozess hat sich vieles in der Welt der Hochschulen verändert. Das Ziel dieser Reform bestand darin, ein einheitliches Hochschulsystem zu schaffen, das eine größere Vergleichbarkeit ermöglicht. Das hat in Deutschland zu einer höheren Belastung für Studierende und Lehrende geführt, da ein erhöhter Prüfungsbedarf die Folge war. Daher wurde jetzt auf der Tagung GML² darüber diskutiert, inwiefern computergestützte Prüfungen eine Entlastung darstellen können. Welche Chancen und Aufgaben gehen mit elektronischen Prüfungen einher? Getroffen hat man sich am 19. und 20. März 2015 an der Freien Universität Berlin. Mit dabei waren nationale und internationale Menschen aus den Bereichen Lehre, Forschung und Wirtschaft. Viele Fragen gehen mit den Computer-Prüfungen einher, die hier beantwortet werden sollten. Einen Rückblick auf die Tagung gibt es in diesem Artikel.
Die GML² 2015 an der Freien Universität Berlin
Schon seit 2003 findet diese Tagung jährlich statt. GML steht dabei für die Grundfragen Multimedialen Lehrens und Lernens. In diesem Jahr ging es einmal mehr an die Freie Universität Berlin. Dafür wurden Räumlichkeiten im Henry-Ford-Bau an der Garystraße genutzt. Die Konferenz fand vom 19. bis zum 20. März statt und im Anschluss wurde von den Teilnehmern Nicolas Apostolopoulos, Alexander Schulz und Wolfgang Coy ein Tagungsband veröffentlicht. In diesem Jahr ging es um das Thema der „E-Examinations – Chances and Challenges”. Das bedeutet, dass man sich mit dem Thema der computergestützten Prüfungen auseinandergesetzt hat.
Vor Ort der GML²-Tagung 2015 waren auch Keynote-Sprecher anderer Hochschulen. Dazu zählen Elisabeth Katzlinger-Felhofer von der Johannes Kepler Universität Linz, Thomas Tinnefeld von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Rob Peregoodoff von der British University of Columbia, Kanada, und Geoffrey Crisp von der Universität Melbourne, Australien. Man unterteilte das Hauptthema in verschiedene Segmente. Das waren Recht und Sicherheit, Good-Practice-Szenarien und Sicherung der Prüfungsqualität und zu Prüfungssoftwarelösungen. Schon im Vorfeld der diesjährigen Tagung konnte man das E-Examination Center der Freien Universität besuchen.
Programm der GML² 2015
Ab 12:30 Uhr gab es den Check-In, um 13 Uhr folgte die Eröffnung durch Peter Lange, Kanzler der Freien Universität. Anschließend folgte die Begrüßung durch Professor Dr. Nicolas Apostolopoulos vom Center für Digitale Systeme der FU. Danach ging es direkt mit dem ersten Keynote-Vortrag von Professor Geoffrey Crisp los. Er sprach zum Thema “Educational Advantages of Computer-based Examination”. Nach einer kurzen Pause begann die erste Session “Good Practice”, die von Professor Dr. Wolfgang Coy moderiert wurde. Rob Peregoodoff hielt den Vortrag “Large-Scale (~1400), fully online, BYOD, wireless, LMS high stakes exams: How we do it”.

Es folgte bis zum Vorabend die Session II mit dem Thema Prüfungsdidaktik. Zunächst gab es die “Einführung in die Prüfungsdidaktik” durch Professor Dr. phil. Thomas Tinnefeld. Danach folgten die Vorträge “Bulimielernen verhindern” von Universitätsprofessor Dr. Michael Niedeggen und “Der Progress Test Medizin – eine multizentrische Kooperation zur Erfassung individueller Lernverläufe im Medizinstudium” von Sebastian Schubert. Der Tag endete mit einem Networking-Dinner, das im Alten Krug an der Königin-Luise-Straße durchgeführt wurde.
Das Programm fing am Freitag direkt am Vormittag an. Um 9 Uhr begann die Session III zum Thema “Sicherheit.” Vorträge waren “Prüfungsrechtliche Rahmenbedingungen für elektronische Prüfungen” von Dr. Christoph Jeremias, “Kompetent und sicher: Online-Prüfungen mit Virtueller Desktop Infrastruktur und Safe Exam Browser an der ETH Zürich” von Tobias Halbherr und Kai Reuter und “Verwendung der Bürgerkarte (Digitale Signatur) für E-Assessment” von Professorin Dr. Elisabeth Katzlinger-Felhofer. Es folgten noch zwei weitere Sessions, ehe die Konferenz am Nachmittag zu ihrem Ende kam. Weitere Vorträge waren “Potenziale neuer Fragetypen für die Naturwissenschaften” von Christoph Jobst und “Mündliche Onlineprüfungen auf Distanz: Eine Diskussion der Vor- und Nachteile dieser Prüfungsform” von Marcel Dux.
Der Bologna-Prozess
1999 wurde eine europaweite Reform beschlossen, die nach ihrem Ursprungsort benannt wurde. 29 Bildungsminister aus Europa unterzeichneten eine Erklärung, mit der man dafür sorgen wollte, ein einheitliches Hochschulsystem zu schaffen. Dadurch sollte die Mobilität für Studierende und Absolventen erleichtert werden, die somit in ganz Europa studieren könnten. Unter anderem wurde daher das Bachelor- und Master-System eingeführt, das die klassischen Diplome und Magister abgelöst hat.
Außerdem hat man sich auf das European Credit Transfer System geeinigt, durch das einheitliche Leistungspunkte vergeben werden können. Generell gilt es, die Qualität der Hochschulbildung zu erhöhen. Die Veränderungen gingen auch mit einer höheren Belastung der Hochschulen einher.
Fazit zur GML²-Tagung 2015 in Berlin